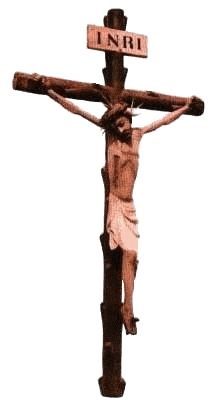22.04.2017
Jetzt amtlich: Das neue verfassungswidrige Schnüffel-Gesetz von Heiko Maas 
von Jane Simpson | Das neue Maas-Gesetz gegen Meinungsfreiheit ist verfassungs- und europarechtswidrig, wie Sie hier lesen… Sagen Sie Ihre Meinung, so lange Sie noch können Rechtzeitig vor der Bundestagswahl legte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vor einer Woche einen Gesetzesentwurf vor, dass die Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook, die sich nicht ausreichend um die Löschung von sogenannten „Hasskommentaren“ kümmern, mit drastischen Bußgeldern bestraft werden sollen. Die Bußgelder können, angefangen bei 5 Millionen EUR bis zu 50 Millionen EUR gegen das jeweilige Unternehmen liegen. Mosseri, der Vice President der News Feed von Facebook, versuchte leider erfolglos klarzumachen, dass zwei Milliarden Menschen nicht auf „Fake News“ und „Hasskommentare“ geprüft werden können. Zudem könne Facebook nicht entscheiden, was wahr und unwahr ist und man könne den Usern keine Meinung aufzwingen. Es werde mit technischen Mitteln zwar versucht, „Volksverhetzung, Mobbing und Fake News“ zu löschen, jedoch könne der Algorithmus nicht alle von Maas geforderten Zensuren leisten. HEUTE VORMITTAG hat das Kabinett den Gesetzentwurf von Maas beschlossen. Justizminister Heiko Maas will jetzt nun also Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube dazu zwingen, gegen Straftaten wie Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung und Volksverhetzung stärker als bislang vorzugehen. „Die Anbieter sozialer Netzwerke stehen in der Verantwortung, wenn ihre Plattformen missbraucht werden, um Hasskriminalität und strafbare Falschnachrichten zu verbreiten“, erklärte Maas nach dem Kabinettsbeschluss. „Für strafbare Hetze dürfe in sozialen Netzwerken genauso wenig Platz sein wie auf der Straße. Das Internet präge Debattenkultur und gesellschaftliches Klima im Land. Verbalradikalisierung ist oft die Vorstufe zur körperlichen Gewalt“, sagte der Minister. Deswegen werde es künftig Geldbußen von bis zu 50 Millionen Euro geben, sagte Maas weiter. „Das ist notwendig, weil die Unternehmen selbst nichts gemacht haben.“ Die Plattformen sollen verpflichtet werden, „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ binnen 24 Stunden zu löschen. Opposition kritisiert das Gesetz „Das Verfahren von Bundesminister Maas ist eine bodenlose Unverschämtheit“, sagte die Grünen-Rechtsexpertin Renate Künast. Es ist dilettantisch, einen nicht in Brüssel notifizierten Entwurf ins Kabinett zu bringen“. Künast sieht in dem von Bundesjustizminister Heiko Maas entworfenen und heute Vormittag vom Kabinett verabschiedeten Gesetz gegen Hasskommentare im Internet vielmehr ein Risiko für die Meinungsfreiheit: „Meine Angst und die von vielen ist, dass die Version, die Maas vorgelegt hat, dazu führt, dass am Ende auch Meinungsfreiheit scharf eingegrenzt wird, weil einfach nur gelöscht, gelöscht, gelöscht wird“. Der Ansatz von Maas sei „im Prinzip“ nicht falsch, sagte Künast. In seiner bisherigen Form sei das Gesetz aber „fast eine Einladung dafür, nicht nur wirkliche Beleidigungen am Ende zu löschen, sondern sicherheitshalber alles.“ Wie davon auszugehen war, erhielt Maas von Merkel und Schulz volle Unterstützung. Ist es heute doch schon so, dass die Mainstreammedien das Sprachrohr von Politik und Eliten sind. Und jeder, der nicht der „öffentlichen Meinung“ entspricht, riskiert seine Karriere, wird öffentlich diffamiert und schlimmstenfalls politisch und wirtschaftlich zerstört. Mit der Internetzensur wird dann wohl die letzte Möglichkeit der freien Meinungsäußerung und Pressefreiheit genommen. Kommunikation wird unterbunden Was „Hasskommentare“ etc. genau sein sollen, bleibt unklar. Denn worum es Heiko Maas eigentlich geht, ist nicht „strafbare Handlungen“ zu verhindern, sondern „rechtswidrige Inhalte“ zensieren zu lassen. Die Frage dabei ist allerdings, ob diese Vorgehensweise verfassungsrechtlich untermauert ist. Denn dies bedeutete nichts anderes, dass Maas unter Umgehung des Rechtsweges (ordentliches Gerichtsverfahren) willkürlich entscheiden kann, was zensiert wird und was nicht. Der Rechtswissenschaftler Alexander Peukert hat in einem Cicero Artikel das neue „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ genauer untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass der Entwurf „problematische juristische Instrumente“ vorschlägt, um die Löschung von Inhalten zu erreichen. Die Plattformen müssen nicht nur den originalen Tweet oder Post löschen, sondern alle seine Weiterverbreitungen. Außerdem müssen sie „wirksame Maßnahmen“ ergreifen, damit der Inhalt nicht wieder online erscheint. Nicht nur Bilder, sondern auch einzelne Formulierungen und Wörter könnten auf diese Weise kriminalisiert und von vornherein nicht mehr ins Netz gelassen werden – auch wenn sie vielleicht in einem anderen und legalen (z.B. satirischen) Kontext stünden. Solche Filter gelten als besonders effektive und damit gefährliche Zensurinstrumente. Die Verpflichtung zu ihrem Einsatz kommt einer allgemeinen Überwachungspflicht gleich, die allerdings mit dem Europarecht (Artikel15 der E-Commerce-Richtlinie 2000/31) unvereinbar ist.“ Heikel ist auch das nichtöffentliche Gerichtsverfahren ohne Beweisaufnahme, welches erfolgt, sobald das Bundesamt für Justiz der Ansicht ist, dass ein Inhalt rechtswidrig ist. Das Amtsgericht Bonn soll dann in einer „Vorabentscheidung“ die „Rechtswidrigkeit“ des Inhalts feststellen. Gesetz (NetzDG) ist verfassungs- und europarechtswidrig Auch der Rechtsanwalt Prof. Niko Härting hat das Gesetz genau studiert. Härting kommt zu dem Schluss, das Gesetz sei sowohl verfassungs- als auch europarechtswidrig. „Die Meinungsfreiheit ist aus Sicht unseres Justizministers nicht mehr als ein Randthema, das lediglich „kurzen Prozess“ vor dem Amtsgericht verdient. Um welche Inhalte geht es genau? Es geht nicht um strafbare Inhalte, sondern um „rechtswidrige Inhalte“ (§ 1 Abs. 3 NetzDG-E). Dies ist ein bedeutsamer Unterschied, da es etwa bei einem beleidigenden Beitrag nicht auf die Absichten des Verfassers ankommt. Ob der Verfasser mit Beleidigungsvorsatz gehandelt hat, ist unerheblich. Bedenkt man, dass strafrechtliche Ermittlungsverfahren vielfach eingestellt werden, da sich ein Tatvorsatz nicht nachweisen lässt, würde § 1 Abs. 3 NetzDG-E dazu führen, dass sich der Anwendungsbereich der strafrechtlichen Verbotsnormen erheblich erweitern würde. Folgende Strafnormen enthält der Verbotskatalog des § 1 Abs. 3 NetzDG-E: - § 86 StGB – Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen
- § 90 StGB – Verunglimpfung des Bundespräsidenten
- § 90a StGB – Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole
- § 111 StGB – Öffentliche Aufforderung zu Straftaten
- § 126 StGB – Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten
- § 130 StGB – Volksverhetzung
- § 140 StGB – Belohnung und Billigung von Straftaten
- § 166 StGB – Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen
- §§ 185 bis 187 StGB – Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung
- § 241 StGB – Bedrohung
- § 269 StGB – Fälschung beweiserheblicher Daten
Der Normenkatalog ist eine willkürliche Zusammenstellung aus unterschiedlichen Normen die dem denkbar schwammigen Begriffen von „Hate Speech“ und „Fake News“ zugeordnet werden können sollen. Der Umgang mit Beschwerden ist in § 3 NetzDG-E so geregelt: - Die Betreiber sind verpflichtet, unverzüglich von Beschwerden Kenntnis zu nehmen, wobei unter „unverzüglich“ deutlich weniger als 24 Stunden zu verstehen sind, da anderenfalls „offensichtlich“ rechtswidrige Inhalte nicht binnen 24 Stunden gelöscht werden könnten (§ 3
Abs. 2 Nr. 1 NetzDG-E). - Innerhalb von 24 Stunden müssen „offensichtlich“ rechtswidrige Inhalte entfernt werden (§ 3
Abs. 2 Nr. 2 NetzDG-E). - Für rechtswidrige Inhalte, bei denen es an einer „Offensichtlichkeit“ des Rechtsverstoßes
fehlt, gilt eine Löschfrist von 7 Tagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 NetzDG-E). Nicht schlecht staunt der Datenschutzrechtler, wenn er in (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 NetzDG-E) liest, dass entfernte Inhalte zu Beweiszwecken gesichert und im Inland gespeichert werden müssen. All dies ist europarechtswidrig: - Nach Art. 14 Abs. 1 lit. b E-Commerce-Richtlinie sind Plattformbetreiber verpflichtet unverzüglich“ tätig zu werden, wenn sie von einem Rechtsverstoß erfahren. Die „Unverzüglichkeit“ (nach deutschem Recht: „ohne schuldhaftes Zögern“) ist ein flexibler Maßstab, der Raum für den Einzelfall lässt. Der deutsche Gesetzgeber kann diesen Maßstab nicht ohne Richtlinienverstoß in einen fixen Zeitraum von 24 Stunden bzw.7 Tagen verwandeln.„
- Nach Art. 15 E-Commerce-Richtlinie sind Anbieter nicht verpflichtet, proaktiv die eigene Plattform nach Rechtsverstößen zu durchsuchen. Hiermit sind die weitreichenden Rechtsverstoß-Verhinderungspflichten in § 3 Abs. 2 Nr. 6 und 7 NetzDG-E nicht vereinbar.
In § 4 Abs. 5 NetzDG-E wird das Gesetz nahezu rechtsstaatswidrig: Im Streit um Bußgelder soll es einen kurzen Prozess um die Rechtswidrigkeit von Inhalten geben. Zuständig soll ein Amtsgericht sein, das ohne mündliche Verhandlung entscheiden kann und dessen Entscheidung nicht anfechtbar ist. Dass es bei dem „kurzen Prozess“ um nicht weniger geht als um die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), scheint kein Zufall zu sein. Sagen Sie also Ihre Meinung, so lange Sie noch können. Im Internet, bei Freunden und Bekannten oder bei Demonstrationen. Unsere Freiheit schwindet immer schneller: Bargeldverbot, RFID Zwangsverchipung, Meinungsfreiheit. Es ist Zeit, öffentlich Widerstand zu leisten – so lange wir DAS noch können. Ihre
Jane Simpson |